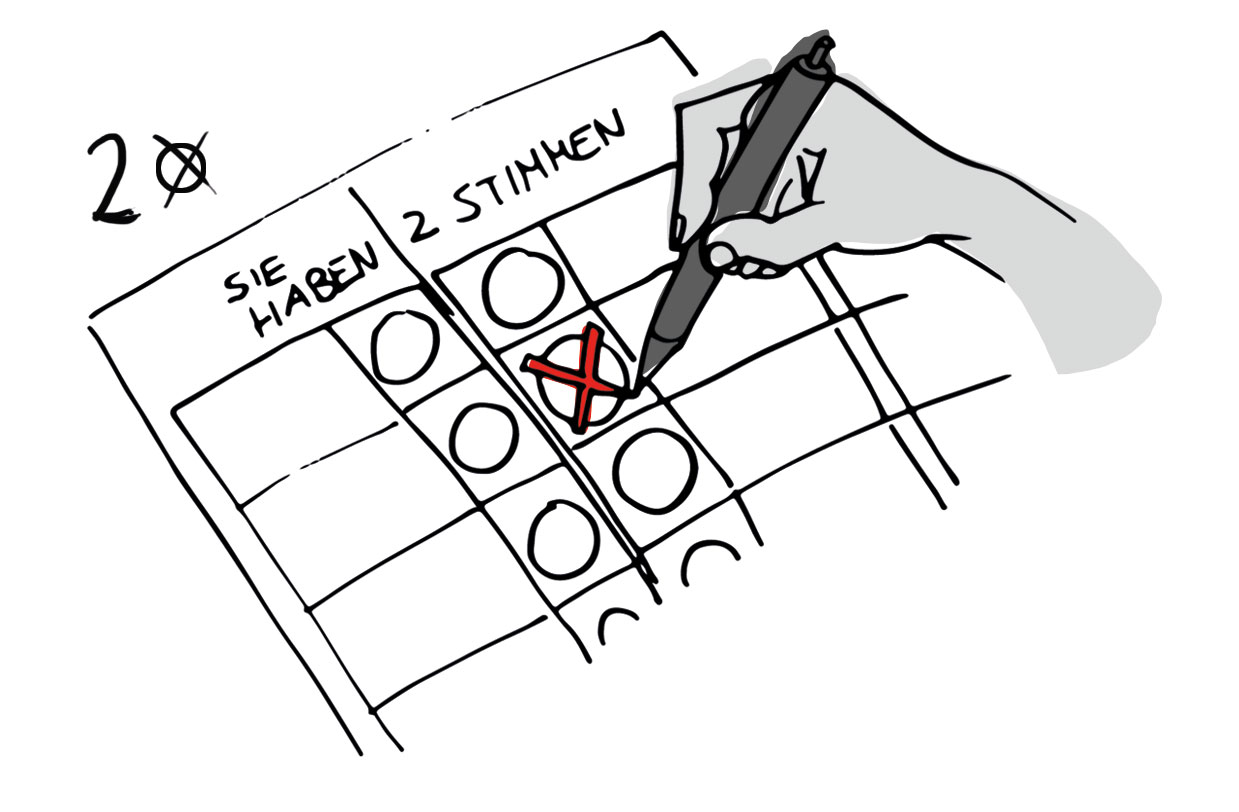Wer wo sein Kreuzchen macht, ist auch eine Sache des Bauchgefühls. Das kann im weltweiten Vergleich so unterschiedlich sein wie auch das Essen selbst. Ein kulinarisch angehauchter Blick auf die Wahl-Unterschiede weltweit.
Andere Länder, andere Sitten – was für das Essen gilt, ist auch beim Wählen nicht anders. Was dem Bayer das Seidl Bier zur Schweinshaxe, ist dem Inder der Lassi zum scharfen Curry. Den erfrischenden Joghurtdrink haben sich die indischen Wahlhelfer aber auch tapfer verdient: Während bei uns in Deutschland die Wahllokale zehn Stunden geöffnet haben, dauert die Wahl in Indien einen ganzen Monat. 714 Millionen Wahlberechtigte waren 2009 aufgerufen, für eine der mehr als 1000 Parteien zu stimmen. Dabei wurde die Wahl von 2,1 Millionen Sicherheitskräften überwacht, während die Inderinnen und Inder geduldig an den 828.800 Wahllokalen warteten. Zum Vergleich: In Deutschland gab es 2009 gerade mal 600.000 Wahlhelfer. Nach der Stimmabgabe wird der indische Finger mit Tinte markiert, damit die Wähler nicht mehrmals abstimmen. In Deutschland reicht ein kleiner Haken auf der Wahlliste.
Das Sternzeichen von Angela Merkel und Peer Steinbrück? Nicht relevant für die Wahl? Am japanischen Wahltisch ist das ganz anders. Denn bevor die Japaner wählen gehen, wollen sie über die Blutgruppe des Kandidaten Bescheid wissen, um damit Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu ziehen. Der Kontrahent der letzten Wahl, Naoki Takashima, hatte Blutgruppe 0: Laut Deutung sei er gesellig und optimistisch, aber auch arrogant und unhöflich. Die Entscheidung fiel schließlich auf Shinzo Abe. Er hat Blutgruppe B und gilt so als aktiver, starker Macher.
Wo Deutsche aus Wahlhunger die Kabinen betreten, werden Australier zwangsernährt: In Down Under herrscht Wahlpflicht. So schaffen die australischen Bürger eine Wahlbeteiligung von knapp 94 Prozent. Zur Besänftigung der Wähler dient das so genannte „Instant-Runoff-Voting“: Die Stichwahl wird gleich im ersten Wahlgang integriert. Nicht mit einem Kreuz wird der Kandidat des Vertrauens markiert, sondern eine Rangfolge unter den Kandidaten festgelegt. Beim Auszählen werden die Kandidaten, die am seltensten auf Position eins stehen, gestrichen, die anderen Kandidaten rücken nach. So wird weiter verfahren, bis einer der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen erhält.
Im Land der unbegrenzten Burgerauswahl läuft es im Wahlkampf dagegen eher wie bei der Entscheidung zwischen Majo oder Ketchup: blau oder rot, Demokrat oder Republikaner. Das Burger-Pommes-Gericht nach Wahl ist aber wohl eines der teuersten der Welt. Rund sechs Milliarden Dollar hat der Wahlkampf 2012 gekostet, umgerechnet circa 4,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In Deutschland wird mit 50 Millionen Euro für den Wahlkampf 2013 gerechnet. Was in den USA über Spenden der Wirtschaft und von Privatpersonen finanziert wird, ermöglicht hierzulande eine staatliche Parteienfinanzierung.
In Deutschland bestimmen die Parteien ohne großes Aufsehen ihre Spitzenkandidaten. In Amerika dagegen werden die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in den sogenannten Primaries gewählt. Aber der Kandidat wird nicht direkt gewählt, sondern Delegierte. Von ihnen ist aber bereits bekannt, für welchen Kandidaten sie abstimmen. Ein Happy Meal ganz ohne Überraschung.